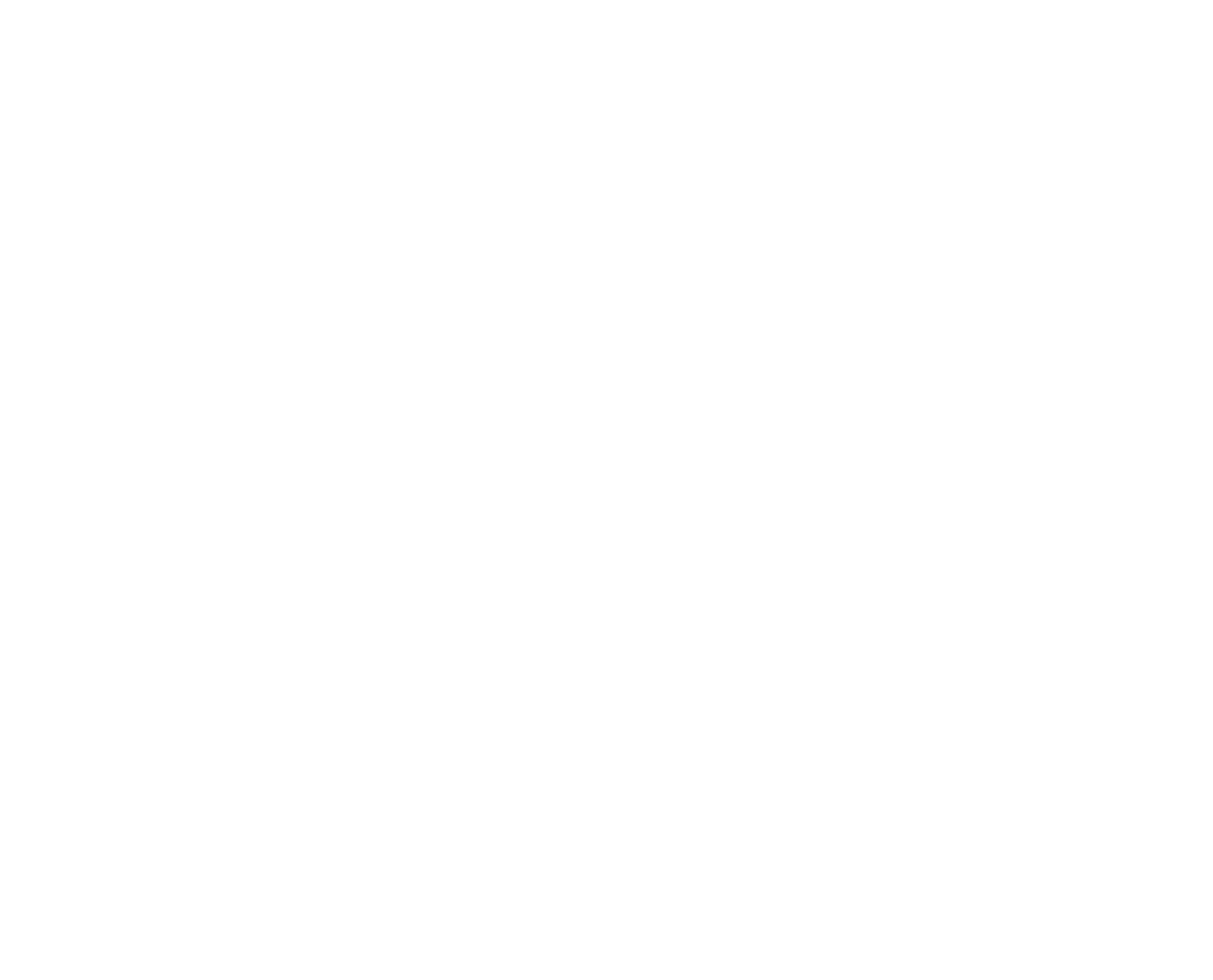Die Corona-Krise trifft wohnungslose Menschen mit besonderer Härte und erfordert schnelle, flexible Lösungen für Betroffene – so viel ist nach dem wachrüttelnden Gespräch mit Stephan Karrenbauer klar. Der Diplom-Sozialpädagoge ist Sozialarbeiter und politischer Sprecher des Hamburger Straßenmagazins Hinz & Kunzt. Dort unterstützt und berät er Wohnungslose seit 1995 bei der Suche nach einer Wohnung oder Unterkunft, bürokratischen Fragen, Suchtproblemen, Einsamkeit und Geldsorgen. Im Interview haben wir darüber gesprochen, vor welche Herausforderungen Corona die Sozialarbeit stellt, inwiefern der Pandemie-bedingte Leerstand in den Städten eine Chance für Wohnungslose sein kann und warum auch in der Sozialen Arbeit mehr experimentiert und evaluiert werden sollte.
Das Interview mit Stephan Karrenbauer fand am 15.02.2021 statt. In Deutschland ist die Zahl der registrierten Neuinfektionen in den letzten Wochen stark zurückgegangen. Die Debatte über Lockerungen Corona-Maßnahmen nimmt weiter Fahrt auf.
Urban Change Academy: Wie erlebst Du die Corona-Pandemie persönlich?
Stephan Karrenbauer: Ich erlebe sie als extrem demotivierend für die Sozialarbeit. Ich bin zum ersten Mal in einer schweren, schweren Krise. Einerseits erhalten wir ganz viel Zustimmung und Spendengelder, um Wohnungslosen Unterstützung anzubieten, andererseits erlebe ich ein Versagen seitens der Behördenleitung, das ich so noch nie gesehen habe. Alle laufen mit Maske rum, wodurch es schwieriger ist, Kontakt zu Wohnungslosen aufzunehmen. Da wir mit vielen Menschen zu tun haben, die wenig oder schlecht Deutsch sprechen, ist die Mimik ganz entscheidend, um ins Gespräch zu kommen. Dadurch kommt es zu vielen Missverständnissen. Was die Atmosphäre betrifft, ist unsere Arbeit ganz anders geworden. Wir müssen so viel erklären wie noch nie zuvor. Die Öffentlichkeit möchte wissen, warum das Hilfesystem für Wohnungslose während des ersten Lockdowns zusammengebrochen ist. Ganz wichtig ist uns: Wir hatten keine Angst, dass wir uns bei den Menschen anstecken, sondern dass wir sie anstecken. Wohnungslose gehören zu einer Gruppe, die ein schwaches Immunsystem haben und wir sind diejenigen, die das Virus aus dem Skiurlaub mitgebracht haben könnten.
Wie wirkt sich Corona für die Wohnungslosen aus?
Seit Dezember sind 13 Obdachlose verstorben. Seit ich hier arbeite, gab es das noch nie. Wir tun, was wir können. Durch die hohe Spendenbereitschaft ist es möglich, neue Hilfsmaßnahmen anzuschieben. Zusammen mit der Diakonie und anderen Partnern konnten wir 170 Wohnungslose in Hotels unterbringen. Das läuft wirklich gut aber bei dieser großen Anzahl an Menschen kann immer etwas schiefgehen. Das ist ein sehr großer emotionaler Druck.
Was wünschst Du dir für die nächsten Wochen ganz konkret von der Politik?
Ich wünsche mir eine stärkere Unterstützung: Dass öffentlich gesagt wird, dass wir gute Arbeit leisten. Dass wir mehr Rückendeckung bekommen, wenn etwas schiefgeht und man nicht mit dem Finger auf uns zeigt. Dass die Behörde sagt: Wir können zwar nicht allen ein Einzelzimmer anbieten aber wir versuchen, den Wohnungslosen einen bestmöglichen Schutz zu geben, bis sie eine Impfung bekommen. Ob das machbar ist, kann ich nicht sagen. Aber ich würde mir wünschen, dass man das Ziel gemeinsam aussprechen darf.
In einem Kommentar in Hinz&Kunzt hast Du geschrieben, das Hilfesystem sei mit Corona zusammengebrochen und bis heute nur eingeschränkt wieder in Betrieb. Was bedeutet das für wohnungslose Menschen?
Bis zum heutigen Tag bieten nur sehr wenige Einrichtungen das gleiche Programm wie vor der Pandemie, allein wegen der Hygienekonzepte. Bei Hinz&Kunzt hatten wir einen großen Raum, in dem Wohnungslose immer Kaffee und Tee bekommen haben und sich ausruhen konnten. Dieser Raum ist nun geschlossen und alles läuft über ein paar geöffnete Fenster. Das ist in vielen Tagesaufenthaltsstätten ähnlich – Wohnungslose können sich dort nicht mehr von morgens bis abends aufhalten, sie bekommen nur noch ein Zeitfenster zugeteilt. Und in diesem Zeitfenster müssen sie essen, die körperliche Hygiene erledigen, ihre Post machen und Beratungsgespräche wahrnehmen.
Wohnungslose sind mehr denn je sich selbst überlassen – das konnte man auch schon im Sommer erkennen. Wenn man am Hauptbahnhof umgestiegen ist, hat man so viele Menschen in einem Verelendungsprozess gesehen wie noch nie zuvor. Viele lagen schon frühmorgens im eigenen Urin und konnten sich gar nicht bewegen. Wir haben in der Innenstadt eine Arbeitsgruppe, bei der sich fast alle Sozialarbeiter mit Kontaktbereichsbeamten austauschen. Einem Gerücht zufolge mussten während einer Essensausgabe am Hauptbahnhof mehrere Streifenwagen kommen, weil es zu Schlägereien gekommen war – die Wohnungslosen hatten offenbar Angst, nichts mehr zu essen zu bekommen. Bei vielen Bürgern entstand der Eindruck, dass die Polizei die Essensausgabestelle auflösen wollte. Doch es war genau umgekehrt! Die Polizei versuchte, die Menschen zu sortieren, damit alle etwas bekommen und die Abstände eingehalten werden. Es herrschte eine große Not. Diesen Eindruck bestätigte auch die Leitung der Tageseinrichtung Alimaus. Sie äußerte das Gefühl, dass die Menschen verhungert aussehen. Weil viele Einrichtungen geschlossen waren, hat eine weitere Verelendung stattgefunden – und das muss eigentlich jedem, der mit offenen Augen durch die Gegend läuft, aufgefallen sein.
Ja, schrecklich.
Wirklich, wirklich, wirklich schrecklich. Dass von Dezember bis jetzt 13 Leute verstorben sind, diese Zahl habe ich zuerst angezweifelt. Das hat nichts mit Erfrieren zu tun. Ich finde es schrecklich genug, wenn man auf der Straße sterben muss. Die meisten Menschen sind zudem alleine gestorben. Das liegt einfach daran, dass der Akku bei den Menschen im Sommer schon leer war.
Wenn die Wohnungslosen die Plätze in Sammelunterkünften des Winternotprogramms nicht in Anspruch nehmen, sollte man das eigene Konzept zumindest mal überprüfen. Warum meiden sie diese Orte? Ein wesentlicher Grund ist meiner Meinung nach das trostlose Bild, wenn man jeden Abend dreihundert andere Menschen sieht, denen es zum Teil noch viel schlechter geht als einem selbst – dass man das ertragen muss. Ich stelle es mir persönlich ganz, ganz schrecklich vor, keine Wohnung zu haben, selbst zu sehen, wie ich über die Runden komme und vielleicht noch einen Funken Hoffnung habe, irgendwann wieder eine Wohnung zu kriegen. Und dann muss ich da abends rein. Ich werde jeden Abend von Sicherheitspersonal gefilzt, jeden Abend die gleiche Prozedur. Das macht nicht gesund, das macht krank.
Welche Hilfsangebote haben sich während der Corona-Zeit noch in der Stadt entwickelt?
Es passiert gerade ganz viel im privaten Bereich: Das Schrødingers in der Sternschanze hat eine kleine Zeltstadt aufgebaut. Der Elbschlosskeller hat beim ersten Lockdown eine Suppenküche veranstaltet. Ich begrüße das Engagement der privaten Initiativen. Aber es wird auch für die Fachleute immer schwieriger, mit den privaten Ehrenamtlichen Absprachen zu treffen, um eine gemeinsame Linie zu fahren. Ich habe den Eindruck, dass viele private Organisationen denken, dass wir nicht genug tun würden. Hinz&Kunzt schreit seit 26 Jahren: Wir müssen uns verändern, wir brauchen mehr Wohnraum für Wohnungslose. Es passiert aber nichts. Ich glaube, dass man Wohnungslosen in Zukunft sofort Unterkünfte anbieten und sie so lange dort wohnen lassen sollte, bis sie eine Wohnung kriegen. Wir reden ja nicht von einer unfassbaren Menge an Menschen, die auf der Straße obdachlos sind, sondern von rund 2000. Und ich glaube, das ist eine Zahl, die man in den Griff bekommen kann.
Die Stadt könnte zum Beispiel versuchen, die Zahl der Wohnungslosen in fünf Jahren zu halbieren. Wir nehmen momentan ganz viel billigend in Kauf. Mir fehlt ein Ansatz, der die Ergebnisse der geförderten Projekte untersucht, um ihre Wirksamkeit zu optimieren. Damit wir Projekte identifizieren und ausbauen können, die gut laufen.
Großstädte praktizieren zum Beispiel Housing First und es scheint vielerorts erfolgreich zu sein. Warum wird das nicht in Hamburg eingesetzt? Wenn wir – auch in der Sozialarbeit – neue Wege gehen wollen, müssen wir bereit dazu sein, unsere eigene Arbeit zu überdenken. Dabei geht es mir nicht nur um Behördenstrukturen. Wir brauchen auch Sozialarbeiter, die dazu bereit sind, sich ein Stück weit zu verändern und andere Wege zu gehen.
Was müsste sich aus Deiner Sicht konkret verändern?
Wie sagt man immer so schön? Wir müssen allen Menschen auf Augenhöhe begegnen. Ich glaube, dass man dem mit einem Ansatz wie Housing First ziemlich nahekommt. Es ist aber nicht nur eine Frage der Wohnsituation. Wir haben hier bei Hinz&Kunzt den Vorteil, dass von 38 festangestellten Mitarbeitern ungefähr die Hälfte selbst ehemalige Obdachlose sind. Und wenn wir hier bei einem Thema falsch reagieren, dann werden wir von denen ganz schnell eingenordet. Wir können uns die tollsten Ideen ausdenken – wenn unsere Kollegen das nicht mittragen, dann lassen wir das auch.
Als wir die ersten Obdachlosen im Hotel untergebracht haben, habe ich erlebt, wie eine Hotelmanagerin mit unseren Leuten gesprochen hat – das hat mich sehr beschäftigt. Sie sprach nämlich nicht von Obdachlosen, sondern von Gästen. Und das macht etwas mit den Leuten. Die Frau sorgte telefonisch dafür, dass ein fehlendes Handtuch im Zimmer ersetzt wurde. Der Wohnungslose stand daneben und hörte das Gespräch mit. Ich habe an seinen Augen gesehen, dass sich in dem Moment wirklich etwas verändert hat.
Und genauso ist es mit Housing First: Wohnungslose bekommen bedingungslos eine Wohnung. Wenn sie dann Hilfe brauchen, stehen wir bereit. Im Augenblick läuft es aber genau andersrum. Die Wohnungslosen bekommen eine Wohnung, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen: Sie müssen ihre Schulden regulieren, Ärzte aufsuchen und ihre Zähne sanieren lassen. Sie müssen sich in einer vorübergehenden Wohnung gut verhalten, dann bekommen sie irgendwann den Mietvertrag auf ihren Namen. Dadurch werden sie klein gemacht. Dieses Verhalten – das ist nicht gesund.
Neben dem Abbau von Hürden – was muss noch passieren?
Wir müssen Wohnungslosen mehr Möglichkeiten geben. Vor ein paar Jahren habe ich ein kleines Projekt in München besucht. Da gab es einen Raum mit zehn Kochstellen. Deren Ansatz war: Wir kochen nicht für die Wohnungslosen – das sollen sie selbst machen. Sie bekommen Geld zum Einkaufen, Kochgeschirr und dann können sie sich selbst an den Herd stellen. Das hat mich sehr beeindruckt. Man darf nicht vergessen, das Wohnungslose wenig Wahlmöglichkeiten haben. Es wird nie dein Lieblingsgericht gekocht. Du hast kein Mitspracherecht dabei, was auf den Tisch kommt. Du darfst nie sagen: “Das schmeckt aber schlecht”. Wenn du das sagst kriegst du die Antwort: “Wenn es dir nicht schmeckt, dann geh doch woanders hin”.
Was kann jeder von uns tun, um sich für mehr soziale Gerechtigkeit einzusetzen?
Erst einmal zur Kenntnis nehmen, dass es Obdachlosigkeit gibt. Nicht zu glauben, dass alle Bettler, die aus Rumänien oder Bulgarien kommen, bandenmäßig organisiert sind. Zu versuchen, sich vielseitige Informationen zu beschaffen. Man kann natürlich nicht jedem etwas ins Töpfchen schmeißen.
Man kann aber dem Bettler, der regelmäßig vor einem Einkaufsladen sitzt und das als seinen Job betrachtet, einfach mal grüßen. Denn das Grüßen ist ja auch ein Wahrnehmen der Person. Die Menschen, die regelmäßig an der gleichen Stelle stehen haben dann das Gefühl, wieder ein Stück dazuzugehören. Und wenn man den Anblick gar nicht mehr ertragen kann, hat man auch die Pflicht gegen diese Missstände anzugehen. Man kann sich engagieren, man kann sich bei der Behörde beschweren. Ich habe überhaupt nichts gegen Ehrenamtlichkeit. Schwierig wird es für mich, wenn man glaubt, dass die Sozialarbeiter versagt haben und man deshalb sein eigenes Ding macht. Das sollte immer gemeinsam mit Menschen passieren, die das professionell machen. Es geht darum, dieses Wissen und die Erfahrung miteinander zu teilen.
Sind Homeoffice und Stadtflucht eine Chance, das Thema Unterbringung von Obdachlosen nochmal ganz anders anzugehen, weil in den Städten mehr freie Räume entstehen?
Ja, ich hoffe es. Die Handelskammer hat sich schon beim ersten Lockdown damit auseinandergesetzt, dass es eine starke Veränderung im Innenstadtbereich geben muss. Da waren ganz konservative Leute dabei, Geschäftsführer von Einkaufshäusern, die gesagt haben: “Wir müssen uns mit jungen Leuten zusammensetzen. Wir können nicht immer nur sagen, dass diese Ideen der jungen Leute völlig verkehrt sind, wir müssen uns für ganz neue Ideen öffnen”. Dazu gehört auch die Umwandlung von Büroflächen in Wohnraum im innerstädtischen Bereich. Das wird aus meiner Sicht auf die Immobilienbesitzer zukommen.
Welche Fähigkeiten brauchen Städte, Behörden und Institutionen in Zukunft?
Behörden oder Städte haben in der Regel die entsprechenden Ressourcen, um schnellstens eine Veränderung hervorzurufen. Aber dazu gehört auch, den Mut zu haben, wirklich eine Veränderung durchzuziehen. Privatpersonen kriegen so etwas immer nur im Kleinen hin. Vielleicht sollte man auch darüber nachdenken, den Bürgern ein gewisses Spielgeld zur Verfügung zu stellen, wenn die Behörden sich nicht trauen, etwas selbst in die Hand zu nehmen.
Ich würde gerne sehen, dass auch im sozialen Bereich Experimente durchgeführt werden. Und wenn es nicht klappt, sollte man auch den Mut haben, ein Projekt wieder einzustampfen. Manchmal habe ich bei Projekten den Eindruck, dass sie auf immer und ewig bestehen sollen. Besser wäre es, in kleineren Zeiträumen zu denken und dann eine Auswertung zu machen. Ich glaube, dass damit auch ein neuer Schwung und neue Ideen kommen.
Bei Hinz&Kunzt haben wir mal für vier Jahre einen Schrebergarten gehabt. Drei Jahre ist es gut gelaufen: Da gab es eine Gruppe, die Gemüse angepflanzt hat. Im vierten Jahr hat sich keiner mehr darum gekümmert. Da haben wir das Projekt wieder gestoppt. Dieser Anspruch, Neues auszuprobieren ist ganz wichtig. Oder das Flughafenprojekt: Spende dein Pfand. Das war ein Versuch, dort etwas zu bewegen. Wir haben für Menschen, die direkt von der Straße kamen, vier Arbeitsplätze geschaffen. Sie tragen dafür Sorge, dass am Flughafen eine Müllreduzierung stattfindet.
Vielen Dank!
Bildquelle: © Andreas Hornoff