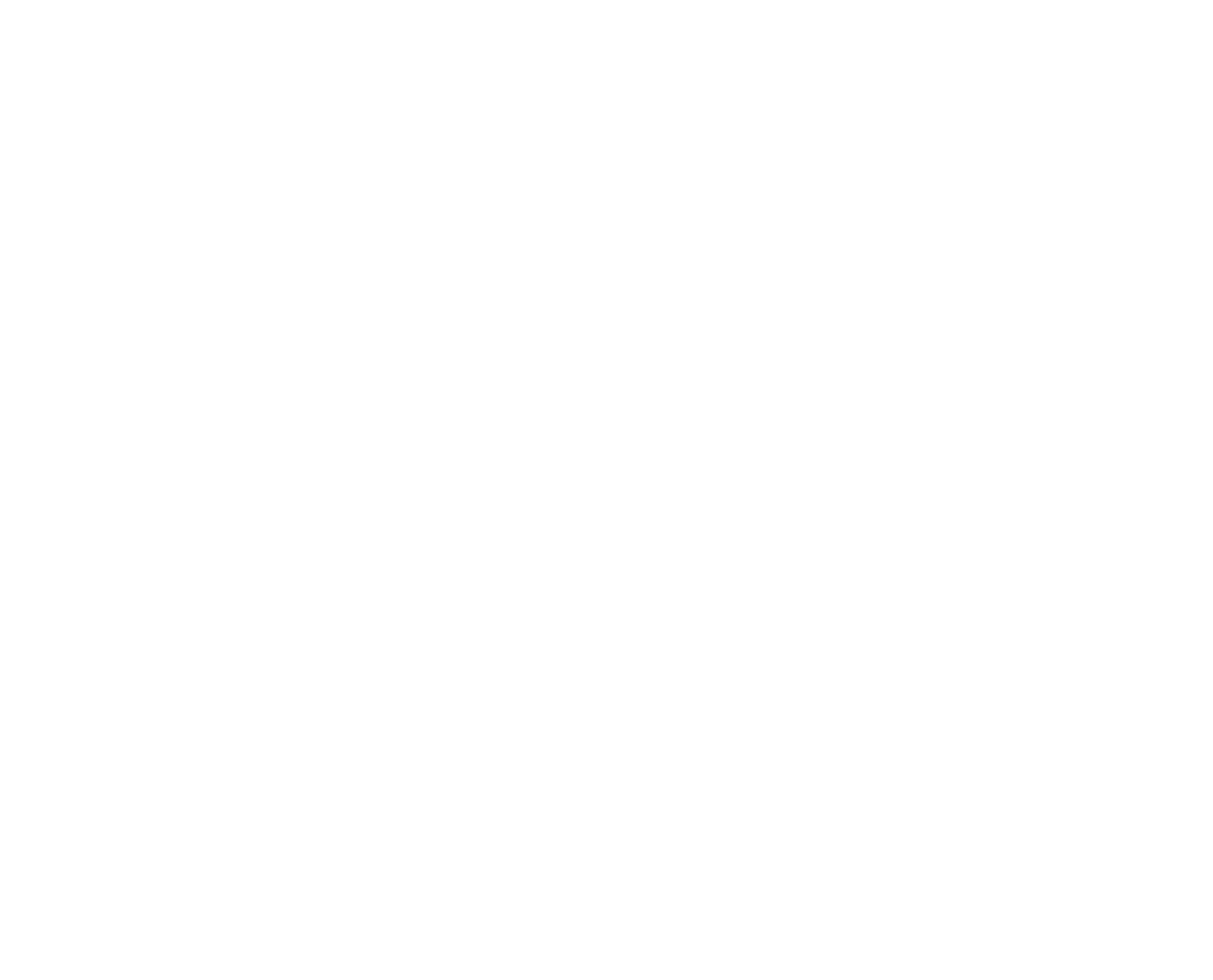Für Amelie Deuflhard, Intendantin und künstlerische Leiterin der internationalen Spiel- und Produktionsstätte Kampnagel in Hamburg, ist die Stadt immer auch eine Bühne. Beispiele dafür gibt es viele: vom partizipativen Kunstprojekt im öffentlichen Raum der Hamburger Hafencity bis hin zur Zwischennutzung des entkernten Palasts der Republik in Berlin. Die gebürtige Stuttgarterin studierte Romanistik, Geschichte und Kulturwissenschaften in Frankfurt am Main, Tübingen und Montpellier, bevor es sie für viele Jahre nach Berlin verschlug. Dort übernahm sie ab 2000 die Geschäftsführung und künstlerische Leitung der Sophiensæle. Ein Gespräch über die Herausforderungen der künstlerischen Arbeit in der Pandemie, den Stillstand des öffentlichen Lebens und seine Folgen, das Potenzial von innerstädtischem Leerstand und die Frage, wie wir die Stadt heute und in Zukunft divers denken können.
Das Interview mit Amelie Deuflhard fand am 04.02.2021 statt. Um die Folgen der Corona-Krise abzufedern, legt die Koalition ein milliardenschweres Corona-Hilfspaket auf, das Unternehmen, Gastronomie und Kultur, ebenso wie Geringverdiener*innen und Familien zugutekommen soll.
Urban Change Academy: Wie erlebst Du die Corona-Pandemie bisher persönlich?
Amelie Deuflhard: Wie wahrscheinlich bei den meisten Menschen hat sich das über diesen langen Verlauf verändert. Ich lasse mich nicht so leicht unterkriegen und habe vielleicht deshalb noch einigermaßen gute Laune. Doch mittlerweile empfinde ich es als eine bleierne Zeit. Der erste Lockdown war wie ein Schock. Ich weiß noch: Wir Theaterintendant*innen und der Chef der Elbphilharmonie, wir konnten uns damals nicht vorstellen, dass wir zugemacht werden.
Kampnagel ist eine Institution mittlerer Größe, ich habe 130 Mitarbeiter*innen. Ich finde, einen Betrieb in diesen Zeiten zu leiten ist eine echte Herausforderung. Vor allem, wenn man sich entschließt, noch irgendwie weiter zu machen. Man kann aber nicht einfach so weitermachen wie bisher. Die ganzen Arbeitsbereiche und Abläufe, die vorher eingespielt waren, die fallen weg. Im Büro arbeiten wir jetzt dezentral mit digitalen und hybriden Meetings.
Für die künstlerische Arbeit ist die zentrale Frage, wie wir unsere Relevanz, auch die gesellschaftliche, die wir auf Kampnagel ganz selbstverständlich behaupten, weiter aufrechterhalten können, wenn wir keine Realräume haben, die wir bespielen können.
Dabei beschäftigen wir uns intensiv mit der Frage, was die Corona-Pandemie für alle Bereiche des Lebens bedeutet – lokal wie global. Es zeigt sich, dass die Auswirkungen für privilegierte Menschen lange nicht so gravierend sind, wie für Menschen, die weniger privilegiert sind. Und das kann man lokal, national oder global beleuchten. In Bezug auf die Verteilung von Einkommen, die Kluft zwischen arm und reich, die Klimakrise, die Ungleichheit in der medizinischen Versorgung oder Flucht und Migration. All diese gesellschaftlichen und globalen Probleme, die im globalen Kapitalismus billigend in Kauf genommen wurden, werden durch die globale Pandemie weiter verschärft.
Globalisierung und Migration sind Themen, mit denen sich Kampnagel intensiv beschäftigt hat. Ihr habt viel mit Migrant*innen gearbeitet. Inwieweit ist es Euch möglich, diese Arbeit fortzuführen?
Wir arbeiten sowohl lokal mit einer migrantischen Diaspora als auch in einer Diaspora von Menschen mit Fluchthintergrund. Global arbeiten wir selbstverständlich mit vielen Künstler*innen aus unterschiedlichen Ländern und Kontinenten.
Der internationale Austausch ist im Moment sehr kompliziert, der interkontinentale fast unmöglich. Ich glaube, das wird leider zunächst so bleiben, wenn wir wieder aufmachen dürfen – hoffentlich im Frühling, aber vielleicht auch erst im frühen Sommer. Das heißt, wir müssen eigentlich unsere Produktionsformen komplett überdenken. Wie wir in Zukunft international arbeiten werden, das ist eine Frage, die komplex ist. Ich gehe erstmal davon aus, dass weiterhin gereist werden wird, aber es wird auch andere Formen des Austausches geben.
Zum Beispiel indem Stücke lokal immer wieder neu produziert werden. Das würde bedeuten, dass das Stück eines internationalen Regisseurs oder einer Choreografin an unterschiedlichen Orten mit lokalen Künstler*innen neu entstehen würde. Bei konzeptionellen Ansätzen ist das häufig möglich, Jérôme Bel praktiziert dieses Prinzip bereits. Man muss aber bedenken, dass es viele Künstler*innen aus anderen weniger privilegierten Kontinenten gibt, die von ihrer Reisetätigkeit leben und deren künstlerische Tätigkeit ohne Reisen nicht möglich wäre.
Wie geht Ihr damit um?
Ein Beispiel: Wir holen den chilenischen Choreographen Jose Vidal Anfang April nach Hamburg. Die Idee ist, dass er hier mit dreißig bis fünfzig sehr bewegungsfreudigen Laien oder halbprofessionellen Tänzer*innen aus Hamburg ein Stück macht, in dem all die Themen, die Corona aufgeworfen hat, aufgegriffen werden. Es geht um Nähe und Distanz, darum wie sich unsere Körperlichkeit in diesen Zeiten verändert hat. Eine wunderbare Herausforderung für einen Choreografen. Jose Vidal hat stets eine sehr intensive, auch dichte Körperlichkeit in seinen Choreographien. Wir planen das jetzt einfach und wissen überhaupt noch nicht, ob und wie wir die Proben umsetzen können!
Also er kommt tatsächlich physisch hier nach Hamburg?
Ja, er kommt physisch hierher. Vielleicht bringt er auch noch zwei, drei Leute aus seinem Kernteam mit. Wir haben ihm klar gesagt, dass wir noch nicht einmal wissen, ab wann er hier real proben kann und wie klein die Gruppe der Menschen sein muss, mit der er probt. Es kann durchaus sein, dass wir von April bis Mai nur digital proben können. Das könnte er dann zwar rein theoretisch auch in Santiago de Chile machen, aber er will gleichzeitig auch recherchieren, um sich hier ein Bild von der lokalen Situation zu machen. Momentan ist meine Strategie, neue Produktionen in unterschiedlichen Szenarien zu denken. Das heißt: Vidals Stück kann auf einer unserer Kampnagel-Bühnen zu sehen sein, es kann im Stadtpark oder im Sankt Pauli Stadion aufgeführt werden oder im schlechtesten Fall kann es digital im Netz zu sehen sein. Bei den Proben müssen die Künstler*innenteams das alles mitdenken, weil der Ort und die Rahmenbedingungen natürlich Folgen für die Inszenierung haben. Eine Herausforderung!
Welche weiteren Auswirkungen haben die Corona-Einschränkungen für Euch?
Die härteste Pandemie-Auswirkung ist für mich persönlich, dass es kein öffentliches Leben mehr gibt. Dass es keine Kunst, keine Theater, keine Veranstaltungen und keine Museen gibt, ist natürlich gravierend; aber das Gravierendste ist, dass es überhaupt keine Zusammenkünfte und Begegnungen mehr gibt, sei es im Büro, im Verein, im Restaurant, in der Bar oder im Club und das wird Folgen haben. Es gibt kaum noch öffentliche Diskurse, dafür fehlen schlicht die Möglichkeiten der Zusammenkunft. Gut – natürlich auf Zoom. Das hat aber aus meiner Sicht eine schwächere Verdrängungskraft als wenn man mit den Menschen in einem Raum ist.
Dass wir keine Orte haben, wie Restaurants, Bars, Theater, Opernhäuser oder das Rathaus, wo man einfach so hingehen kann, Festivals überall auf der Welt, wo man auf Menschen trifft, die man kennt und Menschen, die man nicht kennt. Das gibt es einfach nicht mehr und das ist ein Riesenproblem, weil das auch Auswirkungen auf die politische Debatte hat.
Welche Auswirkungen spürst oder beobachtest Du konkret?
Dinge verschärfen sich und werden dadurch noch sichtbarer, zum Beispiel wie öffentliche Diskurse geführt werden. Dadurch, dass viele Menschen sehr ideologisch auf ihrem Standpunkt beharren, ist eine Diskussion oft nicht mehr möglich. Auch das Aushalten unterschiedlicher Meinungen: Man kann befreundet sein, kann diskutieren, hat unterschiedliche Haltungen und man ficht diese aus. Und danach setzt man sich wieder an den Tisch und trinkt zusammen ein Bier oder isst zusammen Mittag oder trinkt einen Wein. In dieser Form der Auseinandersetzung fehlt uns langsam die Übung. Wir werden gerade ja auch nicht mehr wirklich von Parlamenten regiert im Moment. Angela Merkel und die Ministerpräsident*innen – entscheiden über die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung weitestgehend allein. Früher, also bis letztes Jahr, wurden Entscheidungen demokratisch im Parlament getroffen, aber davon sind wir momentan weit entfernt. Denn die Pandemie macht es erforderlich, dass schnell gehandelt wird. Welche Auswirkungen das auf unsere Demokratie hat, werden wir sehen.
Kunst und Kultur spielen im gesellschaftlichen Diskurs eine zentrale Rolle – man schaut sich ein Stück gemeinsam an, und hat vielleicht eine unterschiedliche Meinung dazu – da fängt es ja schon an. Dass solche Impulse fehlen, fühlt sich für mich wie eine Art von Vakuum an. Wo findet Reflexion noch statt, wenn nicht wie bisher in den verschiedenen kulturellen und künstlerischen Institutionen?
Künstlerische Orte sind Orte der Versammlung. Eigentlich gibt es ja gar nicht mal so viele Orte, wo wir hingehen, um uns mit vielen Menschen zu versammeln. Im Fußballstadion vielleicht noch, das ist auch ein schöner Ort der Versammlung, vor allem im St. Pauli Stadion. Oder ins Theater, wo man ja hingeht, um ein Stück anzuschauen, aber eben auch, um andere Menschen zu treffen. Meistens gehen die Menschen zu zweit, oder auch zu mehreren ins Theater. Aber egal wo sie hingehen, wissen sie eigentlich ziemlich sicher, dass sie dort auch noch andere Menschen kennen werden, weil das Orte sind, die regelmäßig von bestimmten Gruppen besucht werden. Auf Kampnagel lege ich großen Wert darauf, diese Art der Versammlung über das Anschauen des Stücks hinaus zu pflegen. Sei es, dass es danach noch eine Premierenfeier für das Publikum gibt, oder die Besucher*innen die Möglichkeit haben, sich im Restaurant zusammen zu setzen oder bei uns im Club zu tanzen. So verlängern wir die Zeit des Zusammenkommens über die Kunstrezeption hinaus.
Den Versammlungsbegriff habe ich immer sehr stark nach vorne geschoben. Und genau deshalb sind wir Kulturorte fast logischerweise als erste geschlossen worden und werden immer wieder als letzte aufgemacht. Weil wir das Gegenprinzip zu dem sind, was gerade gilt. Nämlich: bleibt zu Hause und trefft euch nur zu zweit.
Es bleibt nicht viel übrig.
Alles, was ich sonst in unseren Städten nutze, gibt es nicht mehr, mein Büro einmal ausgenommen und die Straßen und Parks. Es ist klar, dass die Städte einen Großteil ihrer Funktionen verloren haben – bis auf den Nahverkehr, das Wohnen und das Arbeiten. Sämtliche andere Strukturen, die das urbane Leben ausmachen, sind verloren gegangen. Jeder Grund, warum Menschen in der Stadt wohnen wollen, ist momentan aufgehoben. Wenn man nur über Zoom kommuniziert, muss man nirgendwo bestimmtes mehr sein.
Kampnagel ist ja wirklich eine Art Campus, ein Begegnungsort, es gibt eine Gastronomie, im Sommer den wunderschönen Garten draußen. Ihr spielt auch in den Stadtteil hinein, habt eine Nachbarschaftsfunktion. Die Menschen kommen vorbei, treffen sich, die Kinder können da rumrennen, oder man kommt einfach, trinkt einen Kaffee oder schaut sich irgendwas an. Also das heißt, es gibt ja auch noch eine andere Ebene. Das, was sozial da passiert, das könntest du ja nicht mal eben aus Indien mit einem Zoom-Call machen.
Deswegen bin ich ja auch weiterhin vor Ort und finde wichtig, dass ich auch in Zeiten des dezentralen Arbeitens persönlich ansprechbar bleibe. Eine der schönsten Entwicklungen in Sachen sozialem Leben fand hier auf dem Kampnagel Gelände während des ersten Lockdowns statt, als die Spielplätze geschlossen waren. In unserem Eingangsbereich gibt es eine Betonrampe – die wurde plötzlich von Kindern und Jugendlichen zum Spielplatz transformiert. Zu jeder Zeit waren da Skater, kleine Kinder kamen mit ihren Eltern. Der Vorplatz wurde einfach ein Spielplatz, die Menschen haben sich den öffentlichen Raum einfach neu angeeignet. Verantwortlich natürlich, im Sinne der Corona-Regeln. Das fand ich ganz toll, weil das quasi ein transformiertes soziales Leben ist – aus dem Theater-Eingangsbereich wurde ein Spielplatz gemacht. Das ist natürlich besonders schön, weil wir ja beruflich auch spielen.
Kommen wir noch mal ein bisschen mehr auf Stadt, Gesellschaft und Corona zu sprechen. Du hattest ja auch gesagt, dass es gerade so gut wie kein öffentliches Leben gibt. Wie verändert sich die Rolle der Bürger*innen in einer Post-Corona-Stadt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin überzeugt, dass die Bürger*innen das soziale Leben sofort wieder aufnehmen werden, sobald das wieder erlaubt ist. Ich hoffe, dass Menschen, die schon lange Dinge angesprochen und diskutiert haben, die jetzt so sichtbar geworden sind, in Zukunft eine stärkere Rolle in der öffentlichen Debatte bekommen. Das können akademische oder aktivistische Positionen sein. Bestenfalls bekommen die mehr Gehör. Das wäre eine sehr optimistische Auslegung der Post-Corona-Zeit. Sicher ist das nicht. Ich glaube, dass die Leute, die unsere Gesellschaft, unsere Welt, kritisch begleiten, ohnehin versuchen sollten, sich mehr Positionen im öffentlichen Leben zu erobern. Wir brauchen die öffentliche Debatte!
Wie könnte das bestenfalls aussehen?
Mehr Fokus auf das Soziale, weniger Egoismus. Damit meine ich: nicht nur an den persönlichen Erfolg denken. Entschleunigung ist auch ein interessantes Thema. Der Kapitalismus basiert ja auf dem Motto: höher, schneller, weiter. Dabei hat die Verlangsamung durchaus interessante Aspekte, wenn man das durchdenkt. Vielleicht hinterfragen das jetzt manche Menschen, denen es vorher immer nur darum ging, noch schneller, noch besser zu werden und noch mehr Geld zu verdienen. Dieser brutale Stopp, den wir jetzt alle im Leben haben und hatten, dem kann man ja auch ein paar interessante Aspekte abgewinnen: mehr Zeit zum Nachdenken, nicht so gehetzt zu sein, weniger reisen, weniger Mobilität – das hat sicherlich Nachteile, aber das kann auch Vorteile haben.
Welche Phänomene, die wir jetzt heute noch nicht beobachten, erwartest Du bedingt durch Corona für die Zukunft der Städte?
Eine Entwicklung, die sich schon vor Corona abgezeichnet hat ist, dass Städte heute eigentlich reine Konsumareale sind, die, wenn die Konsummöglichkeiten so wie jetzt geschlossen werden, sehr, sehr unattraktiv sind. Es gibt ja viele Menschen die schon länger sagen, dass wir unsere Städte grüner und autofrei machen müssen. Da könnte Corona wirklich ein positiver Beschleuniger sein. Übrigens, auch diverser in den Nutzungen. Die Innenstadt muss nicht nur aus Geschäften bestehen. Da könnte ja auch mal ein Start-up sein oder eine Kreative, eine Designerin mit ihrer Werkstatt. Dann wäre es viel interessanter, sich da umzuschauen. In Bezug auf Hamburg: Was macht man denn mit den leerstehenden Karstadt- und Kaufhof-Gebäuden? Könnte man doch auch super cool umnutzen.
Wie würdest Du das leerstehenden Karstadt-Gebäude denn nutzen?
Das könnte und sollte man erst mal kulturell zwischennutzen. Und was temporäre kulturelle Nutzungskonzepte angeht – da bin ich Expertin. Zum Beispiel habe ich mit einer Gruppe anderer Akteur*innen den Palast der Republik in Berlin zwischengenutzt. Eine Zwischennutzung ist immer zu allererst ein Experiment. Man schaut, was geht, ohne alles vorher festzulegen – man arbeitet prozessual. In das Karstadt Gebäude könnte man kleinere Läden von jungen Galeristen reinlassen, Startups, Künstler*innen, Coworking Spaces, Ateliers, und und und. So kann entwickelt werden, was es an diesem Ort eigentlich bräuchte. Und aus dem Temporären kommen dann meistens ziemlich schnell Ideen, wie auch eine Nachnutzung aussehen könnte.
Welche Fähigkeiten sind für Dich persönlich wichtig, um jetzt mit dieser Krisensituation umzugehen und auch auf einer anderen Ebene, auf Stadtebene oder Behördenebene, welche Fähigkeiten sind dort wichtig?
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil wir von einer sehr ernstzunehmenden Pandemie sprechen – aber strukturell finde ich Krisenzeiten immer auch interessant. Es sind Zeiten, in denen das Alte teilweise weggefegt wird und sich das Neue im besten Fall entwickeln kann. Mich belebt das eher, als dass es mich lähmt. Ich möchte Lösungen und neue Konzepte entwickeln. Das, was hier in der Pandemie von uns verlangt wird, ist für viele Menschen fast nicht auszuhalten, sie sehen sich plötzlich mit dem Tod konfrontiert, auch junge Menschen. Andere werden extrem ausgegrenzt, zum Beispiel Kinder, die zuhause keine Lernhilfe oder ohnehin Probleme mit der Sprache haben.
Es gibt einerseits privilegierte Menschen, die mit so einer Krise gut umgehen können. Aber es gibt andererseits auch viele, die damit gar nicht umgehen können. Und mit der Fortdauer dieser langen Strecke, die wir wahrscheinlich noch zu gehen haben, wiegt das immer schwerer. Ich denke so langsam, dass man es irgendwie hätte schaffen müssen, differenzierter mit den Corona-Maßnahmen umzugehen und auch andere gesellschaftliche Aspekte mehr einzubeziehen. Die sozialen Probleme, die dahinter lauern, dass die jetzt möglicherweise gar nicht mehr angegangen werden, das finde ich super problematisch. Und ich glaube, da müssen auch neue Ideen entwickelt werden. Aber da wir keinen breiten öffentlichen Diskurs mehr haben – es trifft jetzt nur noch der kleine Club der Chefs und Chefinnen die Entscheidungen – wird das immer eindimensionaler.
Was sollte eine Urban Change Academy vermitteln?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es zu einer umfassenden gesellschaftlichen Beteiligung kommt. Damit meine ich jetzt nicht, dass jeder Einzelne mitreden soll, sondern dass man möglichst viele Menschen aus möglichst vielen Bereichen dazu holt: verschiedene Generationen, Männer, Frauen, Einwanderer, Geflüchtete, Homosexuelle, Heterosexuelle, Transgender und so weiter. Unterschiedliche Wirtschaftszweige, Soziologen, Wirtschaftswissenschaftler, Pfarrer von mir aus – das ist ja auch ganz interessant, was die sagen würden, wie eine Stadt zukünftig funktionieren kann. Ein Bündnis aus unterschiedlichen Denker*innen verschiedener Richtungen und mit unterschiedlichen Herkünften, das wäre interessant und kann neue Perspektiven eröffnen. Da fällt mir jetzt noch ein konkretes Beispiel ein: das Altersheim der Zukunft. Wir denken immer, dass nur Deutsche im Altersheim sitzen. Was ist denn zum Beispiel mit den alten Menschen, die in Anatolien groß geworden sind? Die bekommen Essen, das ganz anders ist, als sie selbst gekocht haben. Wir müssen unsere Gesellschaft divers denken, denn die Stadt (heute) und in der Zukunft ist divers und das muss da mitgedacht werden, also nicht nur unterschiedliche Disziplinen, sondern auch – vielleicht lernen wir das irgendwann – dass wir ein Einwanderungsland sind und sich Menschen aus ganz vielen Herkünften in den Städten versammeln.
Vielen Dank!
Bildquelle: © Julia Steinigeweg