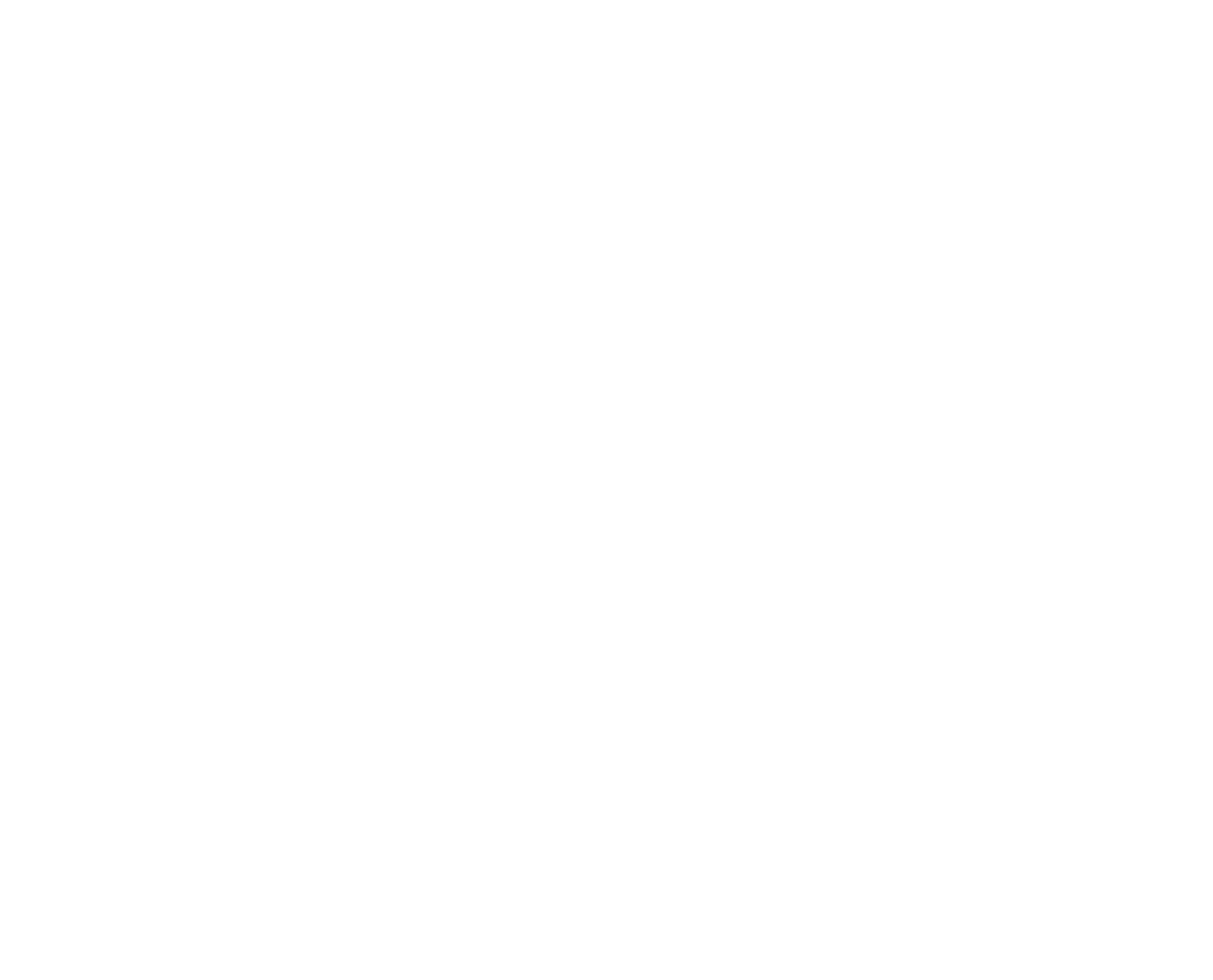Dieter Läpple ist emeritierter Professor für Stadtforschung an der HafenCity Universität Hamburg. Viele Jahre leitete er das Institut für Stadtökonomie an der TU Hamburg und lehrte und forschte in Berlin, Amsterdam, Paris, Aix-en-Provence, Marseille und Leiden. Er war Fellow der Brookings Institution in Washington, Berater des „Urban Age“-Programms der London School of Economics und ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Singapore-ETH Center: „Future Cities Laboratory“. Wir haben uns mit ihm darüber unterhalten, wieso Corona die Commons wieder in den Mittelpunkt der Stadtentwicklungspolitik rückt, was Innenstädte von Quartierszentren lernen können und wie wir auf städtischer Ebene Zukunft gestalten können.
Das Interview mit Dieter Läpple fand am 25.09.2020 statt. Die Corona-Neuinfektionen in Deutschlands Nachbarländern steigen. Die Bundesregierung erklärt ganz Tschechien, Luxemburg und das österreichische Bundesland Tirol zu Corona-Risikogebieten.
Urban Change Academy: Wir reden ja immer gerne davon, dass wir mehr Ausnahmezustände in der Stadtentwicklung brauchen. Jetzt haben wir einen, der ganz massiv ist. In welchen Bereichen spürst Du die Veränderungen ganz besonders?
Dieter Läpple: Es herrscht eine tiefe Verunsicherung, die sehr unterschiedlich verarbeitet wird. Auf den ersten Blick scheint es, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung relativ diszipliniert verhält. Allerdings macht sich inzwischen immer mehr Erschöpfung breit. Eine Minderheit verdrängt den Ausnahmezustand. Vor allem aber bleiben viele Folgen dieses Ausnahmezustandes unsichtbar. Um es mit Brecht‘s Dreigroschenoper zu sagen: Die einen stehen im Dunkeln, die anderen stehen im Licht. Die im Lichte kann man sehen, die im Dunkeln sieht man nicht. Ich denke, die wichtigsten Auswirkungen gibt es bei den Menschen im Dunkeln. Also an den sozialen Brüchen und Grenzen in der Stadt. Wir sehen nicht die Armut, insbesondere kaum die Kinderarmut – die findet hinter verschlossenen Türen statt. Wir sehen nicht die Probleme beim Tele-Learning der migrantischen Familien. Wir sehen nicht die Kurzarbeit, wir sehen die Menschen nicht, die ihren Job verloren haben. Was wir sehen, sind Leute, die eine Sehnsucht nach einer neuen Sozialität haben und sozial präsent sind. Interessant sind zum Beispiel die Versuche einer sozialen Aneignung der Straßen. Dies war zumindest in der Zwischenphase der selektiven Öffnungen eine bemerkenswerte Entwicklung.
Was beobachtest Du noch?
Besonders interessant ist, dass die Arbeit wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt. Zunächst, was als systemisch notwendige Arbeit bezeichnet wurde, also zum Beispiel Arbeit im Krankenhaus, an der Supermarktkasse oder bei der Müllabfuhr. Heute haben wir diese Formen der Arbeit fast schon wieder verdrängt. Inzwischen rückt – als neuer Hype – das Homeoffice in den Mittelpunkt der Diskussion, vielfach verbunden mit einer gewissen Glorifizierung. Gesehen werden zunächst die neuen Freiheiten. Man spart den Weg ins Büro, ist nicht mehr den Zwängen einer hierarchischen Organisation ausgesetzt. Aber dahinter verbergen sich jedoch auch neue Unternehmensstrategien. Für die Beschäftigten ist das Homeoffice vor allem ein Versuch, mehr Autonomie zu bekommen, mehr Zeitsouveränität. Für die Unternehmen dient das sogenannte „Homeshoring“ dazu, Probleme und Kosten in die Haushalte auszulagern. Es werden Strategien entwickelt, wie man Büroflächen und Büroeinrichtungen einsparen kann. Früher oder später wird es zu einer Spaltung der Belegschaften kommen. Die einen werden in standardisierbare Arbeitsprozesse abgedrängt, die man letztlich auch als „Clickworking“ über digitale Plattformen „outsourcen“ kann. Bei den anderen werden sich vielleicht hybride Arbeitsformen aus einer Mischung von Präsenzarbeit und Remotearbeit etablieren. Auf jeden Fall sind wir mit einer Umbruchsituation konfrontiert, wo sehr aufmerksam geschaut werden muss, was passiert, wer sind die Akteure, wer gestaltet die Entwicklungen, welche Dynamiken und Einflussfaktoren stecken dahinter?
Wenn Du die letzten Monate Revue passieren lässt: Welche Räume in der Stadt haben an Bedeutung gewonnen?
Die große Lehre von Corona ist die zentrale Bedeutung der Commons oder der Daseinsvorsorge. Also Bereiche, die keiner direkten Verwertungslogik unterworfen sind und auch keiner direkten Disziplinierung durch den Staat. Es erwies sich als äußerst bedeutsam, dass wir öffentliche Gesundheitssysteme haben, dass wir öffentliche Räume haben, die Möglichkeiten bieten, die isolierte Wohnung zu verlassen und neue Formen der Kommunikation zu finden. Da, wo die Commons weniger ausgeprägt sind, wird die Gesellschaft extrem verletzlich. Vor allem diejenigen, die sowieso schon in einer prekären Situation sind, zum Beispiel beengt wohnen, haben dann keinen Spielraum mehr auszuweichen. Probleme kumulieren sich dann innerhalb der Wohnung – zum Beispiel in der Form häuslicher Gewalt. Das heißt, die Commons sind auch ein Ventil, eine Öffnung der Privatheit und eine Brücke zur Öffentlichkeit. Für mich ist eine der zentralen Aufgaben, die Commons weiter auszubauen.
Wie kann das aussehen?
Wir müssen die Idee der Allmende wieder aktivieren: Wir brauchen Formen der Daseinsvorsorge, die von der Zivilgesellschaft verwaltet und genutzt werden, wobei die elementaren Nutzungsregeln in der Zivilgesellschaft ausgehandelt werden sollten. Was wir gerade auf den Straßen erleben, entspricht dieser Logik: Die Leute halten sich nicht mehr an die Straßenverkehrsordnung, sondern gehen auf die Straße und versuchen, den Shared Space zu antizipieren und Verhalten so auszutesten, dass man den schwächsten Verkehrsteilnehmer zumindest berücksichtigt. Das ist eine Art Spiel, indem neue Regeln entwickelt werden, ohne auf den Staat zu warten. Wichtig wäre, dass der Staat solche Prozesse und die damit verbundenen Kompromisse aufgreift, sie weiterentwickelt und ihnen über entsprechende Governance-Strukturen eine Stabilität gibt. Dies gilt übrigens nicht nur für den sozialen und kulturellen, sondern auch den kommerziellen Bereich.
An welchen kommerziellen Bereich denkst Du da?
Nehmen wir die Diskussion über den Niedergang der Innenstadt. Über Jahrzehnte hat man versucht möglichst viel Kaufkraft in die Stadt zu ziehen. Die Folge: eine Vermarktung der Innenstadt und der öffentlichen Räume. Dadurch hat sich ein urbaner Kannibalismus durchgesetzt, durch den über exzessive Mietforderungen die Stärkeren die Schwächeren rausgedrängt haben. Man hat zerstört, was die Innenstadt eigentlich ausmachen müsste: die Vielfalt, die Aufenthaltsqualität und den Eigensinn des öffentlichen Raumes. Jetzt zu versuchen, dieses System durch staatliche Subventionen zu retten, verlängert nur die Probleme. Wir haben jetzt die Chance, darüber nachzudenken, wie wir wieder zu öffentlichen Räumen kommen, die nicht dem Markt unterworfen sind. Wo man sitzen kann, ohne dass man gegen Geld etwas konsumieren muss. Es geht schließlich um das urbane Herz der Stadtgesellschaft. Gleichzeitig müssen wir eine Strategie finden, um wieder Vielfalt und Lebensqualität in die Stadt zu bekommen. Hier lohnt ein Blick nach Frankreich. Als in Paris der letzte Buchladen zu verschwinden drohte, wurde die „Coeur-de-la-ville“-Strategie entwickelt, um das „Herz der Stadt“ zu retten. Der Staat hat richtig Geld in die Hand genommen, um leere Ladenlokale aufzukaufen und sie wieder an eigentümergeführtes Gewerbe zur vermieten oder eventuell auch zu verkaufen. Mit anderen Worten, die Stadt interveniert, um die Versorgungsqualität und die Aufenthaltsqualität zu retten. Sie behandelt die Ladenlokale als ein Stück Daseinsvorsorge und Infrastruktur und gibt den Innenstädten so wieder eine Perspektive. Dieser Strategie liegt der Gedanke einer „urbanen Rendite“ zugrunde, über die sich diese Strategie mittelfristig für die Stadt ausbezahlt, die Stadt wieder ihr „urbanes Herz“ und einen vielfältigen, vitalen Einzelhandel zurückgewinnt. Das sind Handlungsansätze, die auch wir prüfen sollten.
Es ist eine grundlegende ökonomische Regel, dass man investieren muss, um Veränderung hervorzurufen. Die Diskussion wird jetzt auch in Deutschland lauter. Wir schauen immer schnell auf den Bund – könnte das auch eine Länderstrategie sein?
Bei uns in Hamburg tut man sich bisher mit solchen investiven Strategien schwer. Es ist zu diskutieren, ob wir für eine solche investive Strategie einen revolvierenden Sonderfonds einrichten, um besser agieren zu können. Im Moment wird viel Geld in „Flows“ gepumpt, zum Beispiel in der Form von Kompensationen für Einkommensausfälle, was natürlich wichtig ist. Aber es fehlen strategische Investitionen in die Substanz und den Aufbau einer zukunftsfähigen Infrastruktur im oben skizzierten Sinne. Wir können die Innenstadt nicht über Subventionen oder Einkommenskompensationen retten. Wir müssen die Bestandsstrukturen stabilisieren, aufwerten und ihnen teilweise den Charakter von Infrastrukturen geben. Für eine solche Strategie braucht man flexible Handlungs- oder Governancestrukturen und innovative Finanzierungskonzepte.
Damit sind wir beim Thema Innenstadtmanagement. Es gibt hier eine starke Polarität: auf der einen Seite die Verwaltungen, die sich mit neuen Konzepten oder der Wirtschaftsförderung um die Innenstadt kümmern. Auf der anderen Seite die eher händlerorientierten Innenstadtinteressensverbände, die es an vielen Orten gibt. Brauchen wir da eine ganz andere Struktur?
Es reicht natürlich nicht, Blumenkübel aufzustellen und Werbekampagnen zu machen. Entscheidend ist, die Nutzungsvielfalt zu erhöhen. Wir brauchen auf jeden Fall einen kritischen Anteil Wohnen in der Innenstadt. Besonders wichtig sind natürlich die Erdgeschosse – ihre Nutzung prägt den Charakter des Straßenraumes. In dem Zusammenspiel von gewerblichen und gemeinschaftlichen Nutzungen der Erdgeschosse mit dem Straßenraum entfaltet sich urbanes Leben im Quartier. Im Bereich des Neubaus wurden interessante Handlungsansätze entwickelt, die man in modifizierter Weise auch auf eine Innenstadttransformation anwenden könnte.
Bei dem Neubauprojekt der Wiener „Seestadt Aspern“ zum Beispiel wurde eine „Partitur“ für die Gestaltung der Erdgeschosszone formuliert. Dazu gehören: vier Meter Raumhöhe, Transparenz zum öffentlichen Raum und eine belebende, nach außen wirksame Nutzung. Da kommt normalerweise sofort der Einwand: Das ist unter Marktbedingungen nicht realisierbar. Deshalb wurde von der Entwicklungsgesellschaft eine Einkaufsstraßen GmbH gegründet, die die Vermarktung vorbereitet, das Leerstandrisiko übernimmt und die Mietpreise so gestaltet, dass sich ein vielfältiger, den Bedürfnissen des Quartiers entsprechender Nutzungsmix entwickeln kann. Auch diesem Ansatz liegt die Idee einer „urbanen Rendite“ oder „Stadtteilrendite“ zugrunde: lebendige Erdgeschosszonen mit ganz unterschiedlichen gewerblichen, kulturellen und gemeinschaftlichen Nutzungen bedeuten eine gute Versorgungsqualität und sind wichtige Begegnungsorte, die zu einer Entfaltung von urbanem Leben beitragen können. Wie könnte man so ein Modell für ein Bestandsquartier oder einzelne Gebäudeblöcke in der Innenstadt entwickeln? Welche rechtlichen Instrumente sind dafür nötig? Welche Formen der Querfinanzierung sind möglich? Wie müsste die Governance-Struktur gestaltet werden, um derartige Transformationen in Gang zu setzen. Das ist ein Lernfeld, das wir austesten müssen. Der Markt wird es allein nicht richten.
Wenn wir von Innenstädten sprechen, haben wir meistens Großstadtinnenstädte, wie Wien oder Hamburg, vor Augen. Wir haben auch viele Zentren in Klein- und Mittelstädten.
Eins möchte ich betonen: Noch wichtiger als die Innenstädte sind die Zentren in den Quartieren. Meine Vision ist stark geprägt durch die Idee der 15-Minuten-Stadt, wie sie von Anne Hidalgo, der Bürgermeisterin von Paris konzipiert wurde. Also ein polyzentrischer Umbau der Stadt, so dass alle wichtigen Funktionen, die wir im täglichen Leben brauchen, im Laufabstand oder mit dem Fahrrad innerhalb von zehn oder fünfzehn Minuten zu erreichen sind. Mit der historisch gewachsenen polyzentrischen Struktur haben wir in Hamburg gute Ausgangsbedingungen für einen solchen Stadtumbau. Wir haben bereits in vielen Stadtteilen vitale Quartierszentren, wo es Bindungen der Kunden zu den Unternehmen gibt und wo Unternehmen eine aktive Pflege ihrer Kundenbeziehungen betreiben. Einige Unternehmen sind sehr innovativ. Sie versuchen ihre Arbeit mit digitalen Mitteln zu verbessern, richten Quartiersplattformen ein, bieten Bringdienste mit Lastenfahrrädern an. Sie richten ihre Angebote auf spezifische Kundenbedarfe aus und stärken damit die Kundenbindung. Ich denke, dass die Innenstadt viel von den Quartierszentren lernen könnte. Mein Traum wäre es, solche kundenorientierten Strategien mit urbanen Manufakturen zu ergänzen und zu untermauern. Es wäre wunderbar, wenn es gelänge Formen der urbanen Produktion in die Quartiere zu integrieren und damit dem „fluiden“ Handel durch eine Verknüpfung mit Formen der kundenspezifischen Produktion eine Erdung zu geben.
Solche Ideen, die in den Quartierszentren schon teilweise realisiert sind, könnten auch eine Leitorientierung für Zentren in Klein- und Mittelstädte sein.
Könnte die Corona-Krise auch eine Chance sein, die Produktion zurück in die Stadt, zurück in die Region zu holen? Oder ist das nur eine naive Idee?
Diesen Gedanken finde ich nicht naiv. Wir stehen vor der historisch einmaligen Chance, Produktion wieder zurück in die Stadt zu bringen, die auf der Basis digitaler Technologien stadtverträglich und stadtaffin ist. Damit können wir auch Produktion umweltverträglich gestalten und Ansätze einer Kreislaufwirtschaft realisieren. Es gibt bereits sehr gute Ansätze. Träger solcher Prozesse sind in der Regel Gründer, Start-ups, die es in der Krise besonders schwer haben. Wir brauchen dazu ein Programm, das mit der Prämisse startet: Wir setzen auf Erneuerung und dazu brauchen wir die Start-ups, diese Gazellen-Unternehmen. Wir bieten ihnen Entwicklungsmöglichkeiten in der Stadt. Das beginnt zu allererst mit entsprechender Flächenbereitstellung. Und wir brauchen entsprechende Finanzierungsmodelle.
Im technologischen Bereich sehen wir faszinierende Entwicklungen. Als Alternative zu der „stadtfeindlichen“ Massenproduktion, kann eine personalisiert On-Demand-Produktion realisiert werden – zum Beispiel mit einfach zu programmierende Leichtbauroboter und 3D- Druckern. Wir sehen solche Hotspots in New York in der Brooklyn Navy Yard, wir sehen sie in Rotterdam und anderen Städten. Die Frage ist, wie schaffen wir ein Milieu, damit es auch zu einer Verallgemeinerung kommen kann? Ich befürchte, dass die Städte und der Staat damit überfordert sind, die verschiedenen guten Ansätze voranzubringen. Möglicherweise bräuchten wir auch private Träger, so wie die Factory in Berlin, wo sich Investoren zusammengefunden haben, um auf urbanen Produzenten zu setzen und versuchen, dafür auch tragfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Einige der großen Unternehmen in den Gewerbegebieten haben finanzielle Probleme. Welche Zukunft siehst Du angesichts von Corona für die klassischen Gewerbe- und Industriestandorte?
Der produzierende Bereich bildet eine nicht wegzudenkende Grundlage für eine funktionierende Stadt. Grundsätzlich gilt, wir brauchen Mut zu neuen Formen der Durchmischung. Anstelle von monofunktionalen Gewerbegebieten sollten neuen Mischformen von Arbeiten und Wohnen entwickelt werden. Der Gewerbestandort der Zukunft ist die nutzungsgemischte Stadt und nicht das Gewerbegebiet. Die Unternehmen, die jetzt gegründet werden, wollen sich nicht irgendwo in einem monofunktionalen Gewerbegebiet ansiedeln, sondern in einer vitalen, lebendigen Stadt mit Nutzungsmischung. Nicht nur die Medienleute wollen nachmittags in der Umgebung Kaffee trinken oder Mittagessen gehen.
In Hamburg sind vierzig Prozent der Gewerbegebiete qua Gesetz monofunktional: das sind die Hafenflächen. Da gibt es eine völlig disfunktionale Unternutzung der verfügbaren Flächen. Wir haben riesige Flächenreserven und die müssten im Interesse der Stadt und des Hafens geöffnet und aktiviert werden. Der Hafen braucht die städtischen Akteure, er braucht eine vitale, städtische Struktur, die den neuen Produktionsmöglichkeiten auch ein Entwicklungsmilieu bietet. Allerdings: nicht alle produktiven Tätigkeiten lassen sich in durchmischte Quartiere integrieren. Insofern brauchen wir auch in Zukunft Flächen für ausschließlich industriell-gewerbliche Betriebe, aber auch diese Flächen sollten verdichtet und aufgewertet werden, um sie zukunftsfähig zu machen.
Wir haben viel darüber gesprochen, dass wir Commons schaffen und Infrastrukturen stärken müssen, um Städte resilient zu machen. Viele Kommunen haben allerdings große Sorgen, dass sie ihre ambitionierten Programme in den nächsten Jahren nicht mehr finanzieren können. Brauchen wir eine völlige Neuordnung der kommunalen Finanzen?
Ganz sicher muss die Finanzkraft der Kommunen gestärkt werden Wir brauchen auch eine kommunale Entschuldung. Wir müssen die Finanzierung des Aufbaus des öffentlichen Nahverkehrs so regeln, dass die die kommunalen Kassen nicht zu sehr belastet. Im Augenblick nehmen wir sehr hohe Schulden in Kauf, um die Konjunktur in Gang zu halten. Die entscheidende Frage ist: Wie können wir auf städtischer Ebene Zukunft gestalten? Natürlich muss man mit Verschuldung vorsichtig und verantwortungsvoll sein. Aber wenn wir Geld für extrem niedrige Zinsen aufnehmen, um Zukunftsinvestitionen zu machen, die dann wieder eine Rendite abwerfen – dann ist es eine ganz andere Geschichte. Dafür müssen wir die kommunalen Finanzen neu strukturieren und die Kompetenz zwischen Bund, Ländern und Kommunen neu regeln.
Fehlt uns eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung auf der Stadtebene?
Es werden bisher klassische Kosten-Nutzen-Analysen gemacht, die in der Regel viele “externe Effekte”, wie zum Beispiel die städtische Dividende gar nicht berücksichtigen. Da müssten wir zu neuen Beurteilungskriterien kommen. Die bisherigen kameralistischen Regeln, mit denen wir unsere Städte verwalten, sind nicht zukunftsfähig. Wir brauchen neue Finanzinstrumente und Finanzkonzepte, um Commons, Daseinsvorsorge und neue öffentliche Verkehrssysteme so zu finanzieren, dass die Vitalität und die Rentabilität der Städtestrukturen zukunftsfähig erhalten werden. Und nicht im Vorhinein sagen: Dieser Geldbetrag ist da, den können wir investieren und das war es dann. Damit untergraben wir die Zukunftsexistenz unserer Städte.
Vielen Dank!
Bildquelle: © Dieter Läpple