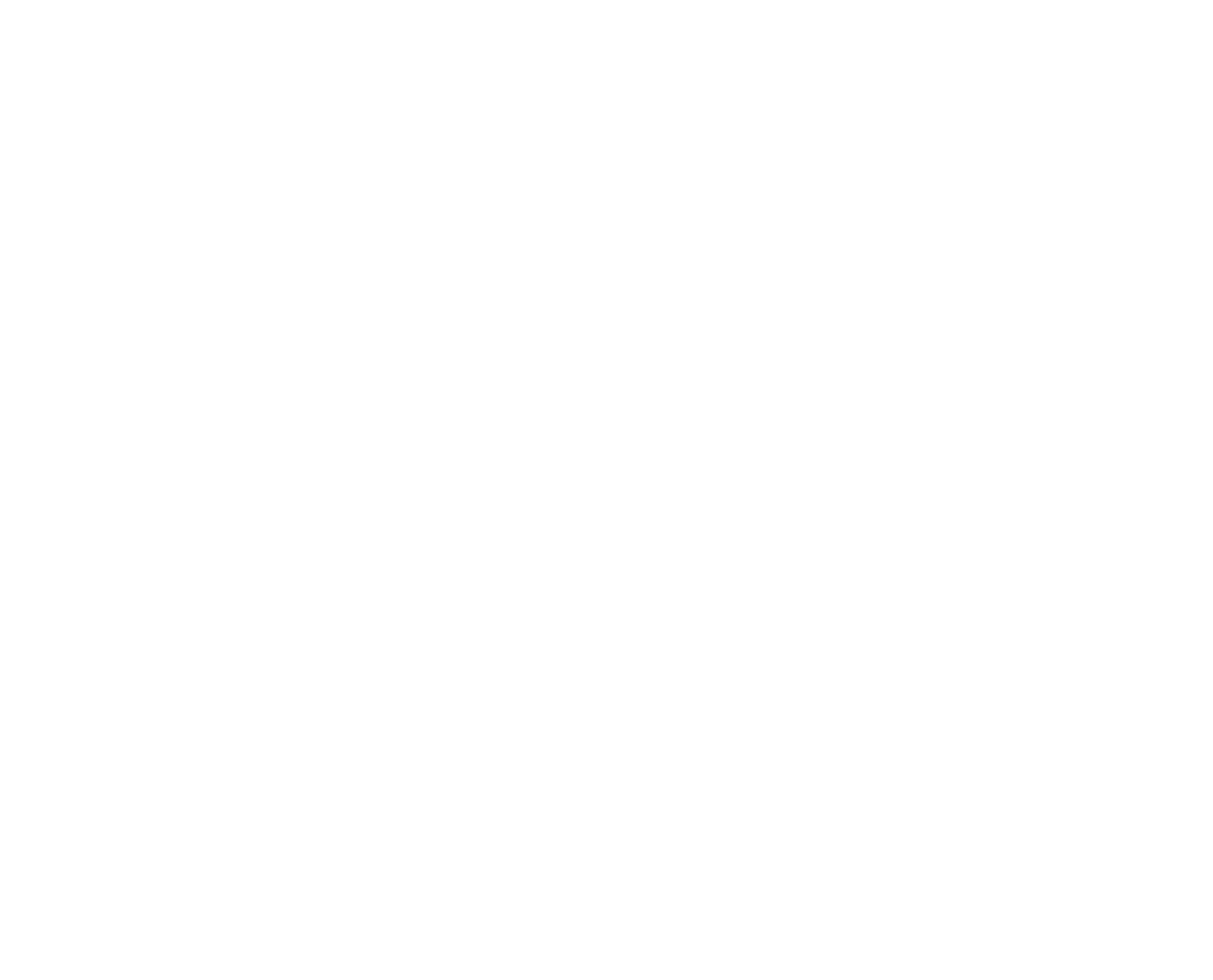Wir sollten uns nichts vom Pferd erzählen lassen, sondern brauchen gut fundierte Analysen zur Bewältigung dieser und folgender Krisen. Davon hat uns der Zukunftsforscher und Mobilitätsexperte Prof. Dr. Stephan Rammler überzeugt. Er ist wissenschaftlicher Direktor des IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung gGmbH in Berlin. Aktuell forscht er zum Zusammenhang von Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
Das Interview mit Stephan Rammler fand am 21.09.2020 statt. Nach einer vorübergehenden Stabilisierung der Fallzahlen auf einem erhöhten Niveau ist ein weiterer Anstieg der Corona-Infektionen in Deutschland zu beobachten.
Urban Change Academy: Wie hat sich Corona in Deinem Leben bemerkbar gemacht? Welche Veränderungen hat es gegeben?
Stephan Rammler: Ich war vor der Pandemie ein sehr aktiver Vortragsreisender und habe es genossen, dass ich im letzten halben Jahr nicht einmal aus Berlin weggefahren bin, weil ich gar nicht musste. Also der rasende Stillstand, den Corona mit sich gebracht hat, der Stillstand im sozialen und im persönlichen. Ich habe zum ersten Mal seit fast zwanzig Jahren einen Frühling in Berlin erlebt. Ich habe meine Kinder viel mehr gesehen. Ich habe meine Frau mehr gesehen.
Ansonsten: Es ist intensiver. Es ist dichter. Ich habe viel gearbeitet.
Die Beobachtung teilen wir auf jeden Fall! Wie wirkt sich die Corona-Krise auf den Umgang mit dem Thema „Zukunft“ aus: Ist es so, dass die Leute weniger über Zukunft reden wollen, oder wird die Nachfrage deutlich größer?
In Krisenzeiten steigt immer der Bedarf an Auguren, Propheten und Glaskugelreibern. Das haben wir seit Beginn der Pandemie auch gesehen. Da werden oft Szenarien entwickelt und verkauft, die erkenntnis-theoretisch überhaupt keine Begründung haben. Das sind reine Marketing Sachen, wo dem Wunsch der Gesellschaft, positive Zukunftsbilder zu bekommen, nachgegangen wird. Das finde ich sehr ärgerlich.
In Krisenzeiten sind Analyse und auch Hoffnung gefragt. Das ist, glaube ich, unsere große Aufgabe als wissenschaftsbasiert arbeitende Zukunftsanalytiker. Die positive Zukunft, die positiven Narrative, also den Blick auf die Frage zu richten, was wir lernen und zum Positiven wenden können, gehört dazu. Aber eben auch, ehrlich zu sein und den Leuten nicht etwas vom Pferd zu erzählen, was da angeblich alles möglich wird.
Meine Wahrnehmung ist, dass viele Zukunftsdiskurse vor der Pandemie einen sehr stark dystopischen Charakter hatten. Wir haben viel über drohende Veränderung gesprochen. Ist in Deiner Wahrnehmung dieses Angstpotenzial durch Corona größer geworden?
Ich glaube, es gibt überhaupt keinen objektiv sachlichen Grund, optimistischer zu sein als vorher. Corona hat uns im Grunde nur den Schleier von den Augen gerissen und auf einige Dinge hingewiesen, die vorher auch schon relevant und richtig waren. Und ich glaube, das haben viele Leute begriffen. Corona ist wie ein Schicksal über uns gekommen und hat bestimmte Entwicklungen und Verhaltensweisen erzwungen. Die Pandemie zeigt uns, nur weil wir gerade zu Veränderungen gezwungen sind, nicht wirklich, was wir als Gesellschaft erreichen können. All die anderen Themen, die jetzt aus der Zukunft auf uns zukommen, haben mit freiwilligen und politischen Entscheidungen zu tun. Die Welt hat sich nicht grundlegend verändert, manche Dinge sind jedoch schwieriger geworden.
Persönlich bin ich der Meinung: Es gibt im Augenblick überhaupt keinen Grund für Optimismus, nicht im Geringsten. Ich sehe viele Gründe zur Warnung und zur Dystopie und das realistische Bild der Zukunft ist eigentlich eher eines, das ich als einen langen Notfall bezeichnen möchte, der auf uns zukommt.
Klimawandel, Ressourcenknappheit und anderes mehr – es gibt viele Herausforderungen und größere Krisen, die auf uns zukommen.
Ich für meinen Teil fühle mich fast ein bisschen befreit. Ich darf jetzt freier über dystopische Szenarien sprechen als vorher. Vorher stand immer schnell der Vorwurf im Raum, man sei Apokalyptiker und Dystopiker, selbst wenn man als Wissenschaftler nur fünf, sechs empirische Tatsachen nebeneinandergestellt hat. Und das hat sich geändert. Man kann die Dinge ein Stück weit offener und freier thematisieren, ohne gleich angegriffen zu werden.
Wie würdest Du den Status quo vor Corona denn beschreiben?
Wir waren in Deutschland und Europa in der politischen und wissenschaftlichen Debatte eigentlich getrieben und getragen durch die Synergie dieser verschiedenen Megatrends, die da gerade für die Mobilität und die Stadtentwicklungen am wichtigsten sind. Nämlich Demografie, Urbanisierung, Nachhaltigkeitstransformation und digitale Transformation. In Sachen der Mobilitätsentwicklung hat sich gerade in den Städten sehr viel getan. Da wäre ich fast positiv. Insbesondere in dem Bereich sehr fortschrittlicher Städte können wir beobachten, dass Transformation möglich ist. Das war der Beginn der Arbeit an einer Verkehrswende. Eine Transformation der Mobilität in Kopenhagen, Stockholm, Amsterdam, Wien.
Man hatte vor Corona das Gefühl, die Dominosteine kippen gerade…
Der Ball lag wie auf dem Elfer im Fußballspiel, die Kommunen mussten ihn an vielen Stellen einfach nur noch versenken. Da wurde der öffentliche kollektive Verkehr modernisiert und digitalisiert, damit er als Rückgrat einer jeden Form nachhaltiger Mobilität der Zukunft bestehen bleiben würde. Wir haben gesehen, dass „Mobility as a Service“ wunderbar integriert werden kann, wenn Stadtentwicklungspolitik das gut macht. Wir haben gesehen, dass Partizipationsprozesse wirklich Sinn machen, und, und, und. Also ich hätte gesagt, die Verkehrswende war zumindest leitbildhaft in einigen Städten Europas und auch in Kalifornien schon im Gange. Und dann kam Corona.
Ist Corona in der Hinsicht ein Showstopper?
Da würde ich sagen: ja und nein. Corona hat ein Stück weit die Kulisse auf der Bühne verschoben, auf der die Verkehrswende gegeben wird. Will heißen: Der öffentliche Verkehr hat einen Attraktivitätsverlust vor dem Hintergrund des sozialen Distanzierungsgebotes. Es kommt zu einer Restabilisierung der Automobilität. Das sind die beiden negativen Aspekte.
Andererseits sehen wir einen wahnsinnigen Boom im Bereich Radverkehr und radverkehrsbasierte Mikrologistik. Wir sehen einen Boom bei Mikromobilität insgesamt. Und wir sehen das zentrale Thema Telependeln. Es ist überraschend, wie schnell die Stadtökonomen, die Stadtpolitiker, aber auch die Immobilienfirmen, darauf reagieren und neue Konzepte für Telearbeit, Telependelzentren für Homeoffice-Architekturen entwickeln.
Vattenfall baut beispielsweise gerade in der Nähe vom Südkreuz in Berlin eine Konzernzentrale, wo maximal sechzig Prozent der Gesamtbelegschaft überhaupt noch gleichzeitig im Gebäude sein können. Das heißt, sie rechnen für fast die Hälfte der Belegschaft systematisch mit Homeoffice. Da hat uns Corona wahnsinnig geholfen. Und die Unternehmen sehen gerade, dass sie wahnsinnig Geld sparen können im Bereich Geschäftsreisen international. Das wird in dem Maße nicht mehr so zurückkommen.
Was kann man gegen die Restabilisierung der Automobilität tun?
Es ist die große Aufgabe für den ÖPNV, Konzepte zu entwickeln, die Corona kompatibel sind oder Pandemie fähig sind. Das ist die Frage nach einer Resilienz der Mobilität in Städten in Zukunft. Ich glaube, dass Pandemien auch systematisch weiterhin auftreten werden. Wir hatten ja im Grunde sehr lange Glück. Wir wussten alle, dass sowas kommen würde. Ich habe selbst vor vielen Jahren Szenarien geschrieben, die das mit aufgegriffen haben. Der ÖPNV muss sich einschließlich der Bahn darauf einstellen, dass Pandemien für sie in Zukunft strukturell ein richtiges Problem sein werden. Also mit beschichteten Oberflächen, mit neu gestalteten Einstiegs-, Ausstiegssituationen, mit guten Belüftungen, mit einer Form neuer Corona Etikette. Es geht um die Frage: Wie bewege und verhalte ich mich im öffentlichen Raum?
Was das Radfahren angeht, spielen die vorhandenen Infrastrukturen eine Rolle. Dass die Berliner und die Hamburger jetzt auch zum Teil gezwungen worden sind, ihre Pop-up-Lanes wieder abzubauen, das halte ich für eine ganz schlechte Nachricht, weil das eine der besten „Reroutinisierungsnudges“ ist, die wir uns denken konnten. Gerade auch für die Leute, die sich vorher nicht mit dem Fahrrad auf die Straße getraut haben. Wir müssen die Infrastrukturen jetzt massiv im Bereich Radverkehr erweitern und ertüchtigen.
Gerade die Situation im ÖPNV ist ein schlimmes Szenario für die Betreiber. Viele von denen haben ja momentan Schweißperlen auf der Stirn, weil sie sagen: Wir sind nur zu dreißig Prozent ausgelastet oder sogar weniger. Das halten wir ökonomisch nicht lange durch. Wie ist da Deine Einschätzung? Muss der Staat hier nochmal ein paar Milliarden locker machen, um lokale ÖPNV Betriebe vor dem Kollaps zu bewahren?
Ich unterscheide immer zwischen Corona als Brennglas und Corona als Reallabor. Brennglas heißt, es zeigt überall die Asymmetrien, strukturellen Defizite, Verwerfungen, Ungleichheiten, die vorher schon da waren, die wir aber entweder nicht sehen wollten oder nicht sehen konnten. Die bringt Corona nach oben, im Gesundheitssystem und auch im Verkehrssystem. Soziale Ungleichheit ist eins der Themen, die Corona ganz deutlich gemacht hat.
Und dann haben wir reallaborhafte Lernerfahrungen, wie zum Beispiel das mit dem Radverkehr oder mit der Telearbeit. Und wir sehen als Gesellschaft: „Huch, da geht doch plötzlich sehr viel mehr, als wir vorher dachten“. Einige dieser Lernerfahrungen werden erhalten bleiben.
Und dann gibt es auf einer abstrakten Ebene natürlich auch Lernerfahrungen oder Analysen, die man machen kann. Eine, die ich für ganz zentral halte ist, dass der starke, auf Daseinsvorsorge orientierte Staat nach dreißig Jahren neoliberaler Deregulierungs- und Liberalisierungspolitik wieder eine Legitimation bekommen hat. Im Grunde ist der starke, vorsorgende, Sicherheit schaffende, resiliente Staat das Postulat der Zeit. Und die Systeme des Verkehrs, vor allen Dingen des öffentlichen Verkehrs, gehören zu den Systemen der öffentlichen Daseinsversorgung. Ich finde, man muss das ganz deutlich sagen: Es gehört dazu, dass der Staat diese Systeme vielleicht stärker als vorher eben nicht rein ökonomisch betrachtet, sondern sehr viel stärker noch mit staatlichen, öffentlichen Geldern reingeht, um eine rudimentäre Form von urbaner Daseinsversorgung in dem Bereich sicherzustellen. Und es muss sich hier nicht alles kostenmäßig selbst tragen. Und da erwarte ich, dass diese Bereiche nicht weiter dereguliert und ökonomisiert werden.
Bereits vor Corona war klar, dass wir eine Kultur des Ausprobierens, der Reallabore brauchen. Die Erfahrung aus der Praxis zeigt aber auch, dass unsere Regulierungssysteme, also von den Straßenverkehrsordnungen bis hin zu den lokalen Genehmigungsbehörden, nicht die dafür nötige Flexibilität mitbringen. Müssten wir da jetzt nicht an den Regeln ansetzten, oder ist das gefährlich?
Nein, das ist nicht gefährlich. Das ist ja eine Lernerfahrung, von der ich hoffe, dass sie bald eintritt und dass wir sie mit Blick auf das, was aus der Zukunft auf uns zukommt, für uns entdecken und bewahren. Nämlich neben einem starken und vorsorgenden Staat den agilen Staat zu haben, der in der Lage ist, seine eigene Pfadabhängigkeit, seine eigenen institutionellen Routinen und Gewohnheiten, seine Determiniertheit durch juristische Lösungen, die vielleicht vor hundert Jahren entstanden und immer noch gültig sind, zu durchbrechen.
Welche Fähigkeiten muss der Staat dafür weiter ausbilden?
Der Staat muss, wenn er seine Rolle als vorsorgender und fürsorgender und Sicherheit schaffender Staat wahrnehmen will, bereit sein, lang gehegte institutionelle Routinen und Gewohnheiten, die jetzt als Barriere wirken, über Bord zu werfen. Oder zumindest temporär zu öffnen, um zu experimentieren, ob man nicht zu anderen juristischen Lösungen kommen kann.
Jede Stadt ist ja unterschiedlich. Jede Gebietskulisse ist unterschiedlich. Und deswegen ist es wichtig, dass Partizipation und Diskurse immer auf kommunaler und regionaler Ebene stattfinden, weil die Engführung zwischen Problemen und Lösungen natürlich nur auf einer kommunalen Ebene in diesem Sinne herbeizuführen sind. Deswegen müssen Kommunen viel mehr in die Lage versetzt, ermächtigt und ertüchtigt werden ihre Probleme selbst zu lösen.
Das heißt, du würdest durch die Corona-Pandemie auch eine Stärkung der Kommunen sehen oder zumindest als wünschenswert erachten?
Ja genau. Ich war vor Corona schon der Meinung, dass die Kommunen die eigentlich entscheidende, die wirklich relevante Handlungsebene der Zukunft sind – jetzt umso mehr. Weil ich glaube, dass den zukünftigen Herausforderungen nicht in der klassischen Art und Weise wie in den letzten sechzig Jahren seit Kriegsende zu begegnen ist.
Die Delegation von Problemen an den Staat nach dem Motto „Staat, lös das mal für mich“, das funktioniert in Zukunft nicht mehr. Es braucht eine sehr viel stärkere zivilgesellschaftliche Bereitschaft mitzuwirken. Das wünsche ich mir, dass wir das wieder entdecken. Kommunitaristische, zivilgesellschaftliche, soziale Prozesse zu Problemlösungen sind immer dann gut, wenn sie lokal oder regional gebunden sind. Weil sie eben mit Fühlungsnähe und sozialer Nähe zu tun haben. Dafür ist die Kommune einfach der richtige Ort.
Ich würde gerne noch auf das Verhältnis von Stadt und Land zu sprechen kommen. Es scheint gerade die Hoffnung zu geben, dass sich durch die Pandemie die Unterschiede zwischen zentralen urbanisierten Räumen und eher dünner besiedelten, nicht zentralen Räumen wieder ausgleichen können. Eben bedingt durch das Telependeln, durch diese neuen Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass wir plötzlich bereit sind, unsere auf die Stadt und auf die Metropole fokussierten Lebensstile zu hinterfragen.
Wir erleben tatsächlich die Urbanisierung des Landes, aber nur bei bestimmten Schwarmstädten: Frankfurt, Hamburg, Berlin, Brandenburg. Man sollte sich in diesem Bereich im Augenblick vor Verallgemeinerung hüten, weil jede Stadt andere Rahmenbedingungen hat. Die Einpendler-Beziehungen in Frankfurt sind andere als in Berlin, andere als in Hamburg. Und die Fähigkeiten oder die Möglichkeiten für die urbane Mittelklasse jetzt aus Berlin rauszuziehen sind andere, als für die urbane Mittelklasse aus Hamburg rauszuziehen. Konzeptionell finde ich die Idee natürlich erstmal toll. Zu dem Thema hatten wir schonmal einen Hype in Verbindung mit dem automatisierten Fahren. Jetzt möchte ich mal die Frage zurückstellen: Wie soll das denn passieren, wenn wir nicht einmal 5G Netze haben und die digitale Ausbaugeschwindigkeit der Infrastruktur hinterherhinkt?
Also wir lernen: infrastructure matters. Und zwar nicht mehr im alten Sinne, sondern im Sinne einer modernen Daseinsvorsorge.
Ja. Die digitalen Netze werden eine wahnsinnig gute Basisinfrastruktur. Wenn wir solche Systeme hätten, dann könnten wir auf dieser Basis ganz andere sozial-technische Einbettungsprozesse für jede Form von digitaler Technologie betreiben: ob es Automatisierungstechnologie im Produktionsbereich ist, im Transport- oder im Logistikbereich oder eben Strukturen des Telependelns. Aber wir haben sie eben noch nicht. Und deswegen bin ich da gerade relativ skeptisch.
Welche Rolle spielen dabei die Strukturen in Politik und Verwaltung?
Wir kommen aus einer Zeit, in der – gesellschaftstheoretisch formuliert – Struktur und Funktionalität im Grunde das Leitbild waren. Jetzt kommen wir aber in eine Zeit, die vor allen Dingen durch den Klimawandel getrieben ist, wo ich sagen würde: Wir müssen den agilen resilienten Staat entwickeln als einen Staat, der sehr schnell sehr unterschiedliche Lösungen anbieten kann. Was wir brauchen ist genau das Gegenteil dessen, was in der Zeit der struktur-funktionalen Epoche nötig und richtig war, als der Verwaltungsapparat gesorgt hat für Stabilität und Sicherheit. Im klassischen Sinne der Resilienz, im Sinne eines Zurückfederns in die alten Situationen. Und jetzt erleben wir eigentlich eine Neudefinition. Wir nennen die transformative Resilienz. Wir glauben, dass Resilienz nur noch durch Veränderung und Adaptivität möglich ist und nicht durch stabilitätsorientierte struktur-konservative Verhaltensweisen. Insofern ist die klassische Verwaltungspolitik, die klassische Struktur von Bürokratie, die wir kennen, genau das Falsche.
Wir erleben gerade einen großen, kulturellen, soziologischen, ökonomischen und politischen Öffnungsprozess, wie wir ihn seit dreihundert Jahren oder schon länger nicht hatten. Und genau da braucht es eigentlich eine Art von Verwaltung, die genau das Gegenteil von dem ist, was wir bislang hatten. Ob es nun die Universitäten sind, die Stadtverwaltung, es braucht agile Verwaltung und ich würde zum Beispiel sofort sagen: Alles was bislang strukturell auf Dauer gestellt worden ist zu befristen.
Zu befristen?
Ich glaube, ein großes Problem dieses Apparates ist die Sicherheit, die ein Stück weit strukturell dysfunktional ist. Wir brauchen mehr die kreativen Risikoaffinen in den städtischen Verwaltungen.
Ich glaube, es würde uns sehr helfen, in Zukunft mehr über Ziele zu diskutieren, als sich auf bekannte Wege zu konzentrieren. Ich würde unterschreiben, was du vorhin gesagt hast, nämlich dass Resilienz bedeutet, Dinge anders zu machen.
Und zwar permanent. Was ich sagen will, das ist an Dramatik eigentlich gar nicht zu überbieten. Ich behaupte, wir gehen in einen langen Notfall rein. Übrigens Begriffe, die ich von James Howard Kunstler habe, „The Long Emergency“, ein Buch aus den Neunzigern. Sehr zu empfehlen in Bezug auf die Pfadabhängigkeit. Ich möchte behaupten, dass das, was wir gerade erleben, der Beginn eines langen Notfalls ist, in den wir als Weltgesellschaft reingehen.
Muss man das wirklich so als anhaltende Krise definieren?
Ich erlebe immer dann, wenn man ernsthaft und beharrlich beim Begriff des Notfalls bleibt, dass Menschen damit nicht umgehen können. Ich bin immer wieder irritiert, warum Leute dann sofort sagen: Warum muss es immer so negativ gesehen werden? Das ist für mich ein Stück Analyse, das konkret so zu beschreiben. Ich bin ja kein Apokalyptiker, der sagt: Die Welt geht unter. Ich glaube auch nicht daran, dass die Welt untergeht. Die Welt geht noch lange nicht unter. Die Welt wird sehr ungemütlich werden und das muss man ganz deutlich sagen.
Diese positiven Narrative, dieses Erzählen der Welt, wie sie sein könnte – ich habe das ja mit „Schubumkehr“ selber getan: „Die Welt könnte ganz anders sein. Wir müssen nur anders denken.“ Das halte ich wirklich für Opium, weil ich glaube, wir brauchen knallharte Analysen und müssen es den Leuten auch sagen. Und vor dem Hintergrund kommt dann die Ableitung, dass wir natürlich eine resiliente Gesellschaft brauchen, die genau diese Art von permanenter Adaptivität, Flexibilität, Veränderungsbereitschaft erzeugt und als Status quo normal stellt.
Vielen Dank!
Bildquelle: © Amin Akhtar